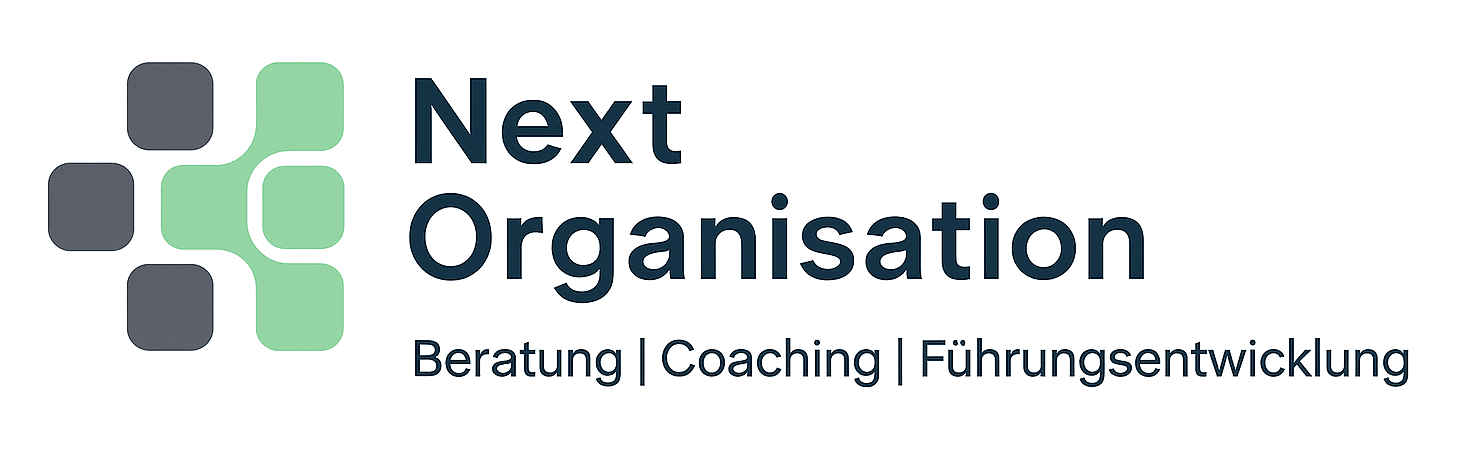Was bleibt von NEW WORK?
Was bleibt von NEW WORK?
Entwicklung der New-Work-Bewegung in Mitteleuropa seit 2017
New Work steht für die durch Digitalisierung und gesellschaftlichen Wandel ausgelösten Veränderungen in der Arbeitswelt. Es umfasst einerseits flexible Arbeitszeiten und -orte, agile Arbeitsformen und partizipative Führungsstile, andererseits auch Werte wie Selbstverantwortung, Sinnhaftigkeit und Empowerment. Bekannte Impulse kamen von Laloux’ Buch Reinventing Organizations (2014), das selbstorganisierte „Teal“-Organisationen als Zukunftsmodell propagiert und von Praktikern als „bahnbrechend“ gelobt wird. Fraunhofer/BMAS definieren New Work als Chancen der digitalen Transformation – etwa eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben oder agiles, innovatives Arbeiten jenseits starrer Hierarchien. In der Praxis wurde der New-Work-Begriff jedoch sehr heterogen aufgefasst und vielfach nur in Teilbereichen („Opportunistischer Containerdiskurs“) umgesetzt. Frithjof Bergmanns ursprüngliches Konzept (Arbeit als freie, sinnstiftende Selbstverwirklichung) ist in Unternehmen heute meist nur noch in Spurenelementen zu erkennen.
Tatsächliche Veränderungen in Unternehmen
Viele DACH-Unternehmen haben seit 2017 zumindest punktuelle Veränderungen eingeführt, vor allem getrieben durch die Pandemie. Studien zeigen etwa: Flexibilisierung der Arbeitszeit und Arbeitsort wurden zu Schwerpunkten. Im New-Work-Barometer 2021 berichten die Autoren, dass Firmen „die vielfältigen Maßnahmen deutlich reduziert und auf Arbeitszeit‐ und Arbeitsortautonomie fokussiert“ haben. Die Corona-Krise beschleunigte insbesondere Homeoffice- und Hybridmodelle. Eine Fraunhofer-Studie (Juni 2025) konstatiert, dass hybrides Arbeiten „zur neuen Normalität“ geworden ist: Rund 60 % der Befragten verteilen ihre Arbeitszeit gleichmäßig auf Büro und Homeoffice. 80 % melden durch die höhere Flexibilität sogar eine gestiegene Produktivität. Zugleich warnt die Studie vor sozialen Schattenseiten: Spontane Begegnungen und informelle Kontakte gehen zurück (fast 30 % fühlen sich dadurch sozial isoliert). Auch eine Langzeitbefragung der Uni Konstanz (April 2025) zeigt: Drei Viertel der Fachkräfte wünschen sich dauerhaft hybride Arbeitsmodelle, und nur etwa jede/r Fünfte erfährt aktuell eine verschärfte Präsenzpflicht. Interessanterweise geht mit dieser Entwicklung eine Veränderung der Führungskultur einher: 2025 fürchten nur 24 % der Führungskräfte noch mehr Abstimmungsprobleme durch Mobilarbeit – im Vorjahr waren es doppelt so viele – und der Wunsch nach höherer Präsenzpflicht ist gesunken. Dies deutet darauf hin, dass hybride Arbeitsformen professioneller gestaltet und akzeptierter werden.
Parallel dazu hat sich die Agilisierung in Teilbereichen fortgesetzt. Laut dem Haufe Agilitätsbarometer 2017 war die Nutzung agiler Methoden damals zwar noch gering (etwa 90 % der Mitarbeiter gaben an, kaum agile Verfahren zu nutzen), aber diejenigen, die sie einsetzten, beurteilten Effektivität und Effizienz zumeist positiv. Auch 2023 stuft die Praxis Agile Projektarbeit weiterhin als zentrales New-Work-Element ein. Insgesamt ist die Verbreitung agiler Methoden aber nach wie vor überschaubar: 2017 arbeitete nur ein kleiner Teil der Unternehmen – vor allem in IT, Vertrieb und F&E – in agilen Teams. Zugleich bleibt die klassische Hierarchie dominant: 2017 empfanden 46 % der Mitarbeiter ihre Führung als traditionell-hierarchisch (2016 waren es 41 %). Die Weckmüller-Studie bilanziert: Von den in New-Work-Debatten propagierten neuen Führungsmodellen sei man also „weit entfernt“.
Gelebte New-Work-Praktiken in der Unternehmenspraxis
In der Praxis haben sich vor allem pragmatische Elemente durchgesetzt. Aus dem New-Work-Barometer 2023 (NWB 2023) ergibt sich: Zu den meistgenannten Maßnahmen zählen empowerment-orientierte Führungsstile, agile Arbeitsmethoden und arbeitsautonome Modelle. Insbesondere werden an oberster Stelle genannt – „ampelgrün“ in der Befragung – zielstrebige Förderung psychologischen Empowerments durch die Führung, Selbstorganisation im Team, eine offene Fehlerkultur, flexible Arbeitsorte/-zeiten und selbstbestimmtes Lernen. Dies spiegelt wider, dass viele Firmen ihre Mitarbeiter befähigen und vertrauensbasierte Arbeitsformen etablieren. Ein Praxisbeispiel ist der Finanz- und Technologiekonzern Hypoport (Stuttgart): Dort wurde 2018 in einer Pilotphase die Holokratie eingeführt. Heute arbeiten neun von zwanzig Tochterunternehmen nach diesem Prinzip (circa 42 % von 2000 Beschäftigten). Hypoport berichtet, agile Werkzeuge (Scrum, Kanban) und digitale Plattformen unterstützen die klare Rollenverteilung und Entscheidungsdezentralisierung.
Weitere gebräuchliche New-Work-Elemente sind inzwischen weit verbreitet: Mobile Arbeit (Homeoffice, Desksharing) und Gleitzeit ist in vielen Firmen Standard geworden – in einer Studie wünschen sich etwa 71 % der Beschäftigten eine Homeoffice-Option für die Jobsuche. Methoden wie Design Thinking oder agile Projektarbeit (z.B. Scrum, Kanban) finden sich vor allem in IT, Produktentwicklung oder projektspezifischen Teams. Kulturmaßnahmen wie regelmäßiges Feedback, Fehlerkultur und Sinnstiftung („Purpose“), die sich in der Literatur große Bedeutung erhoffen, spielen zwar eine Rolle, sind aber oft noch nicht durchgängig implementiert. Kleinere und mittelständische Unternehmen (KMU) setzen New-Work-Prinzipien meist konsequenter um als Großkonzerne: Das NWB 2021 zeigt, dass in KMU partizipative Strukturen leichter umgesetzt werden können und dort Mitarbeiter größere Macht- und Kompetenzerweiterung erleben als in großen Unternehmen.
Wenig verbreitete Ansätze und gescheiterte Konzepte
Viele radikale New-Work-Konzepte haben sich in der Breite nicht durchgesetzt. So zeigt das NWB 2023: Unternehmensdemokratische Praktiken wie eine formale demokratische Organisationsverfassung, Holokratie oder gar gewählte Führungskräfte und Verantwortungseigentum belegen durchweg die hinteren Plätze in der Umsetzung. Diese Modelle spielen in deutschen Unternehmen praktisch keine Rolle. Stattdessen dominieren pragmatische Methoden – etwa agile Projektarbeit und mobile Arbeit – sowie neue Führungsstile. Das Haufe-/Weckmüller-Agilitätsbarometer 2017 hatte bereits konstatiert, dass die meisten agilen Methoden den Beschäftigten unbekannt waren (80 % kannten z.B. Scrum oder Holokratie nur dem Namen nach). Insofern überrascht es wenig, dass klassische Top-down-Strukturen erhalten bleiben: Im New-Work-Barometer 2020 äußerten viele Befragte, dass sie New Work vor allem mit positivem, „auf Augenhöhe“ gelebtem Führungsstil verbinden – die reine Abschaffung von Führung wurde nicht erwartet. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass Teile der New-Work-Bewegung zu simplifizierend aufgefasst werden: Nicht wenige Unternehmen schicken Mitarbeiter zwar mit mehr Freiheit auf die Reise, stärken ihnen aber nicht ausreichend Macht oder Sinnstiftung – einseitige Fokussierung auf Selbstorganisation ohne Empowerment ist verbreitet. So entstehen Situationen, in denen zwar Autonomie wächst, entscheidende Macht aber weiterhin zentralisiert bleibt. Diese Defizite hat das NWB-Analysenteam mit Blick auf Leistung und Mitarbeiterbindung kritisiert: Nur Firmen, die alle Dimensionen psychologischen Empowerments (Kompetenz, Selbstbestimmung, Einfluss/Macht, Sinn) ganzheitlich fördern, erzielen signifikant bessere New-Work-Ergebnisse. In der Praxis führen fehlende Ressourcen und Führung oft zu Überforderung der Beschäftigten, anstatt den erhofften Innovationsschub zu entfalten.
Ein weiteres gescheitertes Konzept ist eine streng hierarchiebefreite Organisation. Wie erwähnt zeigen Befragungen immer wieder, dass klassische Hierarchien noch überwiegen. Beispielsweise bestätigte 2017 das Agilitätsbarometer, dass „das traditionell hierarchische Führungsmodell“ dominant ist – rund 46 % der Mitarbeiter sahen sich weiterhin in einer solchen Struktur. Selbst unter New-Work-Interessierten scheint reines „Führungslos-Sein“ wenig Zuspruch zu finden; vielen geht es vielmehr um partizipative Führung auf Augenhöhe. In den DAX-30-Geschäftsberichten von 2019 fand sich der Begriff „New Work“ kaum (nur ein Unternehmen nannte ihn explizit). Stattdessen dominierten vertraute Schlagwörter wie „Digitalisierung“, „Unternehmenskultur“, „Vertrauen“ oder „Zusammenarbeit“. Das zeigt: Ein Großteil der Unternehmen sieht New Work eher als Schlagwort denn als umfassende Organisationsstrategie, und Bergmanns New-Work-Idee wird oft nur punktuell zitiert.
Gegenläufige Trends: Hierarchie, Bürozwang, Quiet Quitting
Parallel zum New-Work-Ausbau zeichnen sich seit einigen Jahren auch Gegenbewegungen ab. Rückkehr zu Präsenz: Einige Unternehmen versuchen wieder, die Mitarbeiter stärker im Büro zu binden. Studienergebnisse zeigen, dass rund ein Drittel der Belegschaften (33 %) zuletzt eine verschärfte Anwesenheitspflicht erlebt hat. Etwa 19 % berichten sogar von einer insgesamt strengeren Rückkehrpflicht als noch im Vorjahr. Diese Bürozwang-Politik hat jedoch keine positiven Effekte: Mitarbeiter, die zu mehr Präsenz verpflichtet werden, fühlen sich emotional deutlich erschöpfter – bei keiner spürbaren Produktivitätssteigerung. Laut Konstanzer Forschung deutet alles darauf hin, dass starre Anwesenheitsregeln „oft mehr schaden als nützen“. Nicht zuletzt könnte in manchen Firmen gezieltes Präsenzdrängen als Strategie dienen, Personalkosten zu senken – nach dem Motto „Wer nicht ins Büro will, geht eben“.
Quiet Quitting – also die innere Kündigung oder Dienst-nach-Vorschrift-Haltung – ist ein weiteres Phänomen, das sich nicht zuletzt über Social Media verbreitet hat. Wissenschaftlich ist es allerdings nichts Neues: Arbeitspsychologen verweisen auf einen hohen Anteil unzufriedener oder weniger eingebundener Mitarbeiter (Studien sprechen von ca. 15–69 % inoffiziell disengagiert). Prof. Susanne Blazejewski (Alanus Hochschule) weist darauf hin, dass die Wurzeln von Quiet Quitting in klassischen Konflikten liegen: Unbefriedigende Arbeitsbedingungen, fehlende Wertschätzung und das Nichterfüllen fundamentaler Mitarbeiterbedürfnisse (Autonomie, Entwicklung, soziale Beziehung) führen langfristig zu innerer Kündigung. Solange viele Führungskräfte ihre Mitarbeiter nur als Job-Ressourcen und nicht als Menschen betrachten, bleibt dies ein Risiko.
Hybride und agile HR-Ansätze vs. traditionelle Steuerung: In einigen Unternehmen formieren sich neue HR-Strategien und Führungsrollen (z.B. E Leadership), die stärker auf Empathie, Lernen und datenbasierte Entscheidungen setzen. Diese Ansätze stehen im Gegensatz zu altbekannten Performance-Management-Systemen, die noch bei vielen DAX- und Großunternehmen dominieren. Eine Kienbaum-Studie etwa belegt, dass DAX-Firmen vor allem auf klassische Anreiz- und Controlling-Tools setzen und New-Work-relevante Themen wie Agilität oder Purpose dort nur langsam Eingang finden (oft nur in einzelnen Pilotprojekten).
Verbleibende Elemente und bewährte Ansätze
Trotz der Skepsis sind etliche New-Work-Prinzipien heute fest verankert und haben sich als hilfreich erwiesen. Vor allem hybride Arbeitsmodelle mit flexiblen Arbeitszeiten und Homeoffice sind geblieben – sie werden sogar von Mitarbeitern zunehmend als Standard erwartet. Mobile Arbeit (via Cloud-Tools, Videokonferenzen usw.) gilt inzwischen als normaler Teil des Arbeitsalltags, und zahlreiche Unternehmen haben entsprechende Infrastruktur (VPN, Kollaborationstools) aufgebaut. Die Fraunhofer-Studie betont: Hybrides Arbeiten steigert langfristig oft die Zufriedenheit und Produktivität, solange informelle Kommunikation aktiv gefördert wird.
Partizipative Führung und Empowerment haben sich als wirksame Elemente erwiesen. Führungskräfte, die ihre Mitarbeiter in Entscheidungen einbinden, Sinn stiften und Kompetenzen fördern, können Motivation und Bindung erhöhen. Das New-Work-Barometer 2023 unterstreicht, dass Empowerment-Führung nach wie vor an oberster Stelle steht. Firmen, die sämtlich Komponente von Mitarbeiter-Empowerment fördern (nicht nur Autonomie, sondern auch Einfluss und Sinn), berichten signifikant bessere New-Work-Erfolge (z.B. höhere emotionale Bindung und geringere Fluktuation). Dies untermauern auch Praxiserfahrungen: Viele Unternehmen beobachten, dass engagierte Mitarbeitende schneller lernen und kreativer arbeiten, wenn sie Verantwortung übertragen bekommen und ihre Arbeit als sinnhaft erleben.
Agile Methoden und iterative Arbeitsweisen haben sich insbesondere in Projektbereichen als nützlich erwiesen. Scrum, Kanban und ähnliche Verfahren werden von Teams vor allem in der IT und Produktentwicklung standardmäßig eingesetzt. Beschleunigte Feedback-Schleifen und interdisziplinäre Teams können die Produktqualität und Time-to-Market verbessern – Langzeitstudien hierzu fehlen zwar, doch mehr als 65 % der Anwender in einer Umfrage schätzen Effizienz- und Qualitätsgewinne durch Agilität. Solche Vorgehen erleichtern auch die schnelle Anpassung an wechselnde Anforderungen.
Neue Arbeitskulturen – etwa eine offene Kommunikations- und Fehlerkultur – haben sich vielfach als stabilisierender Faktor erwiesen. Teams, die aus Fehlern lernen (statt sie zu kaschieren) und regelmäßig reflektieren, zeigen tendenziell bessere Ergebnisse. In manchen Branchen (z.B. Softwareentwicklung) ist heute selbstverständlich, dass man in Retrospektiven nach Verbesserungsmöglichkeiten sucht. Ebenso hat sich das Konzept der regelmäßigen „Next-Feedback“- oder OKR-Meetings in vielen Unternehmen etabliert, um Transparenz zu schaffen.
Führungsrollen und HR-Transformation: In einigen Firmen haben sich explizite neue Rollen herausgebildet, etwa Agile Coaches, New-Work-Beauftragte oder Chief Transformation Officers. HR-Abteilungen entwickeln sich zum strategischen Partner: Sie unterstützen Führungskräfte in der Umsetzung von New Work (z.B. durch Training in digitaler Führung, Mindset-Workshops) und nutzen zunehmend datenbasierte HR-Kennzahlen. Der Trend geht dahin, dass HR-Prozesse agiler gestaltet werden (beispielweise flexiblere Weiterbildungsbudgets, kürzere Feedback-Zyklen im Recruiting). Auch das Thema Future Skills (kritisches Denken, Selbstreflexion, Lernfähigkeit) gewinnt an Bedeutung; im NWB 2023 sagten 73,6 % der Befragten, New-Work-Maßnahmen seien notwendig, um im Fachkräftemangel Talente zu gewinnen. Insgesamt wird New Work heute oft als wichtiger Wettbewerbsfaktor für Arbeitgeberpositionierung verstanden.
Ausblick: Weiterentwicklung und Ausgewogenheit
Die New-Work-Bewegung bleibt dynamisch, dennoch sind klare Tendenzen erkennbar: Hybride Modelle werden weiter professionalisiert (z.B. durch getrennte Bürozonen für Kollaboration vs. Fokusarbeit), damit auch langfristig soziale Bindung und Innovation gesichert sind. Führungsrollen entwickeln sich hin zu Coaching- und Mentor*innen-Funktionen, die stärker auf individuelle Bedürfnisse eingehen (z.B. durch individualisierte Zielvereinbarungen oder gezielte Förderung). HR-Organisationen orientieren sich zunehmend an agilen Prinzipien (z.B. „HR-Squads“ für schnellere Prozessgestaltung).
Bei all dem gilt es aber, nicht in Extreme zu verfallen. Forschende mahnen, dass reine Autonomie ohne Sinnvermittlung und strukturelle Unterstützung kontraproduktiv ist. Erfolgreiche New-Work-Organisationen verbinden daher Flexibilität mit klaren Rahmenbedingungen: Sie definieren zwar weniger die Arbeitswege der Mitarbeiter, achten aber umso stärker auf gemeinsame Ziele, transparente Kommunikation und ausreichende Ressourcen. In einer sich wandelnden Arbeitswelt dürfte sich am Ende bewahrheiten, was New-Work-Pioniere schon vor Augen führten: Moderne Unternehmen brauchen weder dogmatisch starre Hierarchien noch utopisch hierarchiefreie Systeme, sondern ein ausgewogenes Modell aus Vertrauen, agiler Steuerung und menschlicher Führung auf Augenhöhe.
Quellen: Wissenschaftliche Studien und Analysen (Fraunhofer, Haufe/Promerit, NWB-Berichte u.a.) sowie Praxisbeispiele und Experten-Interviews. (Vollständige Quellenangaben im Text.)